
Schopenhauer: Zur Ästhetik der Dichtkunst
Beim nachfolgenden Text handelt es sich einmal um § 51 des ersten Bandes von Arthur Schopenhauers „Die Welt als Wille und Vorstellung“ und Kapitel 37. Zur Ästhetik der Dichtkunst aus den Ergänzungen zum dritten Buch im zweiten Band; in der Fußnote des Letzteren heißt esˏ daß es sich auf das Erstere beziehtˏ weshalb es als Fortführung desselben zu erachten ist und ich es für angebracht halteˏ beide Kapitel zu einem zusammenzuführen und unter dem Titel zu veröffentlichen.
§ 51, Kapitel 37. Zur Ästhetik der Dichtkunst von Arthur Schopenhauer
Wenn wir nun mit unsern bisherigen Betrachtungen über die Kunst im Allgemeinen von den bildenden Künsten uns zur Poesie wenden; so werden wir nicht zweifeln, daß auch sie die Absicht hat, die Ideen, die Stufen der Objektivation des Willens, zu offenbaren und sie mit der Deutlichkeit und Lebendigkeit, in welcher das dichterische Gemüth sie auffaßte, dem Hörer mitzutheilen. Ideen sind wesentlich anschaulich: wenn daher in der Poesie das unmittelbar durch Worte Mitgetheilte nur abstrakte Begriffe sind; so ist doch offenbar die Absicht, in den Repräsentanten dieser Begriffe den Hörer die Ideen des Lebens anschauen zu lassen, welches nur durch Beihülfe seiner eigenen Phantasie geschehn kann. Um aber diese dem Zweck entsprechend in Bewegung zu setzen, müssen die abstrakten Begriffe, welche das unmittelbare Material der Poesie wie der trockensten Prosa sind, so zusammengestellt werden, daß ihre Sphären sich dergestalt schneiden, daß keiner in seiner abstrakten Allgemeinheit beharren kann; sondern statt seiner ein anschaulicher Repräsentant vor die Phantasie tritt, den nun die Worte des Dichters immer weiter nach seiner Absicht modificiren. Wie der Chemiker aus völlig klaren und durchsichtigen Flüssigkeiten, indem er sie vereinigt, feste Niederschläge erhält; so versteht der Dichter aus der abstrakten, durchsichtigen Allgemeinheit der Begriffe, durch die Art wie er sie verbindet, das Konkrete, Individuelle, die anschauliche Vorstellung, gleichsam zu fällen. Denn nur anschaulich wird die Idee erkannt: Erkenntniß der Idee ist aber der Zweck aller Kunst. Die Meisterschaft in der Poesie, wie in der Chemie, macht fähig, allemal gerade den Niederschlag zu erhalten, welchen man eben beabsichtigt. Diesem Zweck dienen die vielen Epitheta in der Poesie, durch welche die Allgemeinheit jedes Begriffes eingeschränkt wird, mehr und mehr, bis zur Anschaulichkeit. Homer setzt fast zu jedem Hauptwort ein Beiwort, dessen Begriff die Sphäre des erstem Begriffes schneidet und sogleich beträchtlich vermindert, wodurch er der Anschauung schon so viel näher kommt: z.B.
En d’ epes’ Ôkeanô lampron phaos êelioio,
Helkon nykta melainan eti zeidôron arouran.
(Occidit vero in Oceanum splendidum lumen solis,
Trahens noctem nigram super almam terram.)
Und
»Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht«, –
schlägt aus wenigen Begriffen die ganze Wonne des südlichen Klimas vor die Phantasie nieder.
Ein ganz besonderes Hülfsmittel der Poesie sind Rhythmus und Reim. Von ihrer unglaublich mächtigen Wirkung weiß ich keine andere Erklärung zu geben, als daß unsere an die Zeit wesentlich gebundenen Vorstellungskräfte hiedurch eine Eigenthümlichkeit erhalten haben, vermöge welcher wir jedem regelmäßig wiederkehrenden Geräusch innerlich folgen und gleichsam mit einstimmen. Dadurch werden nun Rhythmus und Reim theils ein Bindemittel unserer Aufmerksamkeit, indem wir williger dem Vortrag folgen, theils entsteht durch sie in uns ein blindes, allem Urtheil vorhergängiges Einstimmen in das Vorgetragene, wodurch dieses eine gewisse emphatische, von allen Gründen unabhängige Ueberzeugungskraft erhält.
Vermöge der Allgemeinheit des Stoffes, dessen sich die Poesie, um die Ideen mitzutheilen, bedient, also der Begriffe, ist der Umfang ihres Gebietes sehr groß. Die ganze Natur, die Ideen aller Stufen sind durch sie darstellbar, indem sie, nach Maaßgabe der mitzutheilenden Idee, bald beschreibend, bald erzählend, bald unmittelbar dramatisch darstellend verfährt. Wenn aber, in der Darstellung der niederigeren Stufen der Objektität des Willens, die bildende Kunst sie meistens übertrifft, weil die erkenntnißlose und auch die bloß thierische Natur in einem einzigen wohlgefaßten Moment fast ihr ganzes Wesen offenbart; so ist dagegen der Mensch, soweit er sich nicht durch seine bloße Gestalt und Ausdruck der Miene, sondern durch eine Kette von Handlungen und sie begleitender Gedanken und Affekte ausspricht, der Hauptgegenstand der Poesie, der es hierin keine andere Kunst gleich thut, weil ihr dabei die Fortschreitung zu Statten kommt, welche den bildenden Künsten abgeht.
Offenbarung derjenigen Idee, welche die höchste Stufe der Objektität des Willens ist, Darstellung des Menschen in der zusammenhängenden Reihe seiner Bestrebungen und Handlungen ist also der große Vorwurf der Poesie. – Zwar lehrt auch Erfahrung, lehrt auch Geschichte den Menschen kennen; jedoch öfter die Menschen als den Menschen: d.h. sie geben mehr empirische Notizen vom Benehmen der Menschen gegen einander, woraus Regeln für das eigene Verhalten hervorgehn, als daß sie in das innere Wesen des Menschen tiefe Blicke thun ließen. Indessen bleibt auch dieses letztere keineswegs von ihnen ausgeschlossen: Jedoch, so oft es das Wesen der Menschheit selbst ist, das in der Geschichte, oder in der eigenen Erfahrung sich uns aufschließt: so haben wir diese, der Historiker jene schon mit künstlerischen Augen, schon poetisch, d.h. der Idee, nicht der Erscheinung, dem innern Wesen, nicht den Relationen nach aufgefaßt. Unumgänglich ist die eigene Erfahrung Bedingung zum Verständniß der Dichtkunst, wie der Geschichte: denn sie ist gleichsam das Wörterbuch der Sprache, welche Beide reden. Geschichte aber verhält sich zur Poesie eigentlich wie Porträtmalerei zur Historienmalerei: jene giebt das im Einzelnen, diese das im Allgemeinen Wahre: jene hat die Wahrheit der Erscheinung, und kann sie aus derselben beurkunden, diese hat die Wahrheit der Idee, die in keiner einzelnen Erscheinung zu finden, dennoch aus allen spricht. Der Dichter stellt mit Wahl und Absicht bedeutende Charaktere in bedeutenden Situationen dar: der Historiker nimmt Beide wie sie kommen. Ja, er hat die Begebenheiten und die Personen nicht nach ihrer innern, ächten, die Idee ausdrückenden Bedeutsamkeit anzusehn und auszuwählen; sondern nach der äußern, scheinbaren, relativen, in Beziehung auf die Verknüpfung, auf die Folgen, wichtigen Bedeutsamkeit. Er darf nichts an und für sich, seinem wesentlichen Charakter und Ausdrucke nach, sondern muß alles nach der Relation, in der Verkettung, im Einfluß auf das Folgende, ja besonders auf sein eigenes Zeitalter betrachten. Darum wird er eine wenig bedeutende, ja an sich gemeine Handlung eines Königs nicht übergehn: denn sie hat Folgen und Einfluß. Hingegen sind an sich höchst bedeutungsvolle Handlungen der Einzelnen, sehr ausgezeichnete Individuen, wenn sie keine Folgen, keinen Einfluß haben, von ihm nicht zu erwähnen. Denn seine Betrachtung geht dem Satz vom Grunde nach und ergreift die Erscheinung, deren Form dieser ist. Der Dichter aber faßt die Idee auf, das Wesen der Menschheit, außer aller Relation, außer aller Zeit, die adäquate Objektität des Dinges an sich auf ihrer höchsten Stufe. Wenn gleich nun auch, selbst bei jener dem Historiker nothwendigen Betrachtungsart, das innere Wesen, die Bedeutsamkeit der Erscheinungen, der Kern aller jener Schaalen, nie ganz verloren gehn kann und wenigstens von Dem, der ihn sucht, sich noch finden und erkennen läßt; so wird dennoch Dasjenige, was an sich, nicht in der Relation, bedeutend ist, die eigentliche Entfaltung der Idee, bei weitem richtiger und deutlicher in der Richtung sich finden, als in der Geschichte, jener daher, so paradox es klingt, viel mehr eigentliche, ächte, innere Wahrheit beizulegen seyn, als dieser. Denn der Historiker soll der individuellen Begebenheit genau nach dem Leben folgen, wie sie an den vielfach verschlungenen Ketten der Gründe und Folgen sich in der Zeit entwickelt; aber unmöglich kann er hiezu alle Data besitzen, Alles gesehn, oder Alles erkundet haben: er wird jeden Augenblick vom Original seines Bildes verlassen, oder ein falsches schiebt sich ihm unter, und dies so häufig, daß ich glaube annehmen zu dürfen, in aller Geschichte sei des Falschen mehr, als des Wahren. Der Dichter hingegen hat die Idee der Menschheit von irgend einer bestimmten, eben darzustellenden Seite aufgefaßt, das Wesen seines eigenen Selbst ist es, was sich in ihr ihm objektivirt: seine Erkenntniß ist, wie oben bei Gelegenheit der Skulptur auseinandergesetzt, halb a priori: sein Musterbild steht vor seinem Geiste, fest, deutlich, hell beleuchtet, kann ihn nicht verlassen: daher zeigt er uns im Spiegel seines Geistes die Idee rein und deutlich, und seine Schilderung ist, bis auf das Einzelne herab, wahr wie das Leben selbst69. Die großen alten Historiker sind daher im Einzelnen, wo die Data sie verlassen, z.B. in den Reden ihrer Helden, Dichter; ja, ihre ganze Behandlungsart des Stoffes nähert sich dem Epischen: dies aber eben giebt ihren Darstellungen die Einheit, und läßt sie die innere Wahrheit behalten, selbst da, wo die äußere ihnen nicht zugänglich, oder gar verfälscht war: und verglichen wir vorhin die Geschichte mit der Porträtmalerei, im Gegensatz der Poesie, welche der Historienmalerei entspräche; so finden wir Winckelmanns Ausspruch, daß das Porträt das Ideal des Individuums seyn soll, auch von den alten Historikern befolgt, da sie das Einzelne doch so darstellen, daß die sich darin aussprechende Seite der Idee der Menschheit hervortritt: die neuen dagegen, Wenige ausgenommen, geben meistens nur »ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer und höchstens eine Haupt- und Staatsaktion«. – Wer also die Menschheit, ihrem innern, in allen Erscheinungen und Entwickelungen identischen Wesen, ihrer Idee nach, erkennen will, dem werden die Werke der großen, unsterblichen Dichter ein viel treueres und deutlicheres Bild vorhalten, als die Historiker je vermögen; denn selbst die besten unter diesen sind als Dichter lange nicht die ersten und haben auch nicht freie Hände. Man kann das Verhältniß Beider, in dieser Rücksicht, auch durch folgendes Gleichniß erläutern. Der bloße, reine, nach den Datis allein arbeitende Historiker, gleicht Einem, der ohne alle Kenntniß der Mathematik, aus zufällig vorgefundenen Figuren, die Verhältnisse derselben durch Messen erforscht, dessen empirisch gefundene Angabe daher mit allen Fehlern der gezeichneten Figur behaftet ist: der Dichter hingegen gleicht dem Mathematiker, welcher jene Verhältnisse a priori konstruirt, in reiner Anschauung, und sie aussagt, nicht wie die gezeichnete Figur sie wirklich hat, sondern wie sie in der Idee sind, welche die Zeichnung versinnlichen soll. – Darum sagt Schiller:
»Was sich nie und nirgends hat begeben,
Das allein veraltet nie.«
Ich muß sogar, in Hinsicht auf die Erkenntniß des Wesens der Menschheit, den Biographien, vornehmlich den Autobiographien, einen großem Werth zugestehn, als der eigentlichen Geschichte, wenigstens wie sie gewöhnlich behandelt wird. Theils nämlich sind bei jenen die Data richtiger und vollständiger zusammenzubringen, als bei dieser; theils agiren in der eigentlichen Geschichte nicht sowohl Menschen, als Völker und Heere, und die Einzelnen, welche noch auftreten, erscheinen in so großer Entfernung, mit so vieler Umgebung und so großem Gefolge, dazu verhüllt in steife Staatskleider oder schwere, unbiegsame Harnische, daß es wahrlich schwer hält, durch alles Dieses hindurch die menschliche Bewegung zu erkennen. Hingegen zeigt das treu geschilderte Leben des Einzelnen, in einer engen Sphäre, die Handlungsweise der Menschen in allen ihren Nuancen und Gestalten, die Trefflichkeit, Tugend, ja die Heiligkeit Einzelner, die Verkehrtheit, Erbärmlichkeit, Tücke der Meisten, die Ruchlosigkeit Mancher. Dabei ist es ja, in der hier allein betrachteten Rücksicht, nämlich in Betreff der innern Bedeutung des Erscheinenden, ganz gleichgültig, ob die Gegenstände, um die sich die Handlung dreht, relativ betrachtet, Kleinigkeiten oder Wichtigkeiten, Bauerhöfe oder Königreiche sind: denn alle diese Dinge, an sich ohne Bedeutung, erhalten solche nur dadurch und insofern, als durch sie der Wille bewegt wird: bloß durch seine Relation zum Willen hat das Motiv Bedeutsamkeit; hingegen die Relation, die es als Ding zu andern solchen Dingen hat, kommt gar nicht in Betracht. Wie ein Kreis von einem Zoll Durchmesser und einer von 40 Millionen Meilen Durchmesser die selben geometrischen Eigenschaften vollständig haben, so sind die Vorgänge und die Geschichte eines Dorfes und die eines Reiches im Wesentlichen die selben; und man kann am Einen, wie am Ändern, die Menschheit studiren und kennen lernen. Auch hat man Unrecht zu meinen, die Autobiographien seien voller Trug und Verstellung. Vielmehr ist das Lügen (obwohl überall möglich) dort vielleicht schwerer, als irgendwo. Verstellung ist am leichtesten in der bloßen Unterredung; ja sie ist, so paradox es klingt, schon in einem Briefe im Grunde schwerer, weil da der Mensch, sich selber überlassen, in sich sieht und nicht nach außen, das Fremde und Ferne sich schwer nahe bringt und den Maaßstab des Eindrucks auf den Ändern nicht vor Augen hat; dieser Andere dagegen, gelassen, in einer dem Schreiber fremden Stimmung, den Brief übersieht, zu wiederholten Malen und verschiedenen Zeiten liest, und so die verborgene Absicht leicht herausfindet. Einen Autor lernt man auch als Menschen am leichtesten aus seinem Buche kennen, weil alle jene Bedingungen hier noch stärker und anhaltender wirken: und in einer Selbstbiographie sich zu verstellen, ist so schwer, daß es vielleicht keine einzige giebt, die nicht im Ganzen wahrer wäre, als jede andere geschriebene Geschichte, Der Mensch, der sein Leben aufzeichnet, überblickt es im Ganzen und Großen, das Einzelne wird klein, das Nahe entfernt sich, das Ferne kommt wieder nah, die Rücksichten schrumpfen ein: er sitzt sich selbst zur Beichte und hat sich freiwillig hingesetzt: der Geist der Lüge faßt ihn hier nicht so leicht: denn es liegt in jedem Menschen auch eine Neigung zur Wahrheit, die bei jeder Lüge erst überwältigt werden muß und die eben hier eine ungemein starke Stellung angenommen hat. Das Verhältniß zwischen Biographie und Völkergeschichte läßt sich durch folgendes Gleichniß anschaulich machen. Die Geschichte zeigt uns die Menschheit, wie uns eine Aussicht von einem hohen Berge die Natur zeigt: wir sehn Vieles auf ein Mal, weite Strecken, große Massen; aber deutlich wird nichts, noch seinem ganzen eigentlichen Wesen nach erkennbar. Dagegen zeigt uns das dargestellte Leben des Einzelnen den Menschen so, wie wir die Natur erkennen, wenn wir zwischen ihren Bäumen, Pflanzen, Felsen und Gewässern umhergehn. Wie aber durch die Landschaftsmalerei, in welcher der Künstler uns durch seine Augen in die Natur blicken läßt, uns die Erkenntniß ihrer Ideen und der zu dieser erforderte Zustand des willenlosen, reinen Erkennens sehr erleichtert wird; so hat für die Darstellung der Ideen, welche wir in Geschichte und Biographie suchen können, die Dichtkunst sehr Vieles vor Beiden voraus: denn auch hier hält uns der Genius den verdeutlichenden Spiegel vor, in welchem alles Wesentliche und Bedeutsame zusammengestellt und ins hellste Licht gesetzt uns entgegentritt, das Zufällige und Fremdartige aber ausgeschieden ist.70
Die Darstellung der Idee der Menschheit, welche dem Dichter obliegt, kann er nun entweder so ausführen, daß der Dargestellte zugleich auch der Darstellende ist: dieses geschieht in der lyrischen Poesie, im eigentlichen Liede, wo der Dichtende nur seinen eigenen Zustand lebhaft anschaut und beschreibt, wobei daher, durch den Gegenstand, dieser Gattung eine gewisse Subjektivität wesentlich ist; – oder aber der Darzustellende ist vom Darstellenden ganz verschieden, wie in allen andern Gattungen, wo mehr oder weniger der Darstellende hinter dem Dargestellten sich verbirgt und zuletzt ganz verschwindet. In der Romanze drückt der Darstellende seinen eigenen Zustand noch durch Ton und Haltung des Ganzen in etwas aus: viel objektiver als das Lied hat sie daher noch etwas Subjektives, dieses verschwindet schon mehr im Idyll, noch viel mehr im Roman, fast ganz im eigentlichen Epos, und bis auf die letzte Spur endlich im Drama, welches die objektiveste und in mehr als einer Hinsicht vollkommenste, auch schwierigste Gattung der Poesie ist. Die lyrische Gattung ist eben deshalb die leichteste, und wenn die Kunst sonst nur dem so seltenen ächten Genius angehört, so kann selbst der im Ganzen nicht sehr eminente Mensch, wenn in der That, durch starke Anregung von außen, irgend eine Begeisterung seine Geisteskräfte erhöht, ein schönes Lied zu Stande bringen: denn es bedarf dazu nur einer lebhaften Anschauung seines eigenen Zustandes im aufgeregten Moment, Dies beweisen viele einzelne Lieder übrigens unbekannt gebliebener Individuen, besonders die Deutschen Volkslieder, von denen wir im »Wunderhorn« eine treffliche Sammlung haben, und eben so unzählige Liebes- und andere Lieder des Volkes in allen Sprachen. Denn die Stimmung des Augenblickes zu ergreifen und im Liede zu verkörpern ist die ganze Leistung dieser poetischen Gattung, Dennoch bildet in der lyrischen Poesie achter Dichter sich das innere der ganzen Menschheit ab, und Alles, was Millionen gewesener, seiender, künftiger Menschen, in den selben, weil stets wiederkehrenden, Lagen, empfunden haben und empfinden werden, findet darin seinen entsprechenden Ausdruck. Weil jene Lagen, durch die beständige Wiederkehr, eben wie die Menschheit selbst, als bleibende dastehn und stets die selben Empfindungen hervorrufen, bleiben die lyrischen Produkte achter Dichter Jahrtausende hindurch richtig, wirksam und frisch. Ist doch überhaupt der Dichter der allgemeine Mensch: Alles, was irgend eines Menschen Herz bewegt hat, und was die menschliche Natur, in irgend einer Lage, aus sich hervortreibt, was irgendwo in einer Menschenbrust wohnt und brütet – ist sein Thema und sein Stoff; wie daneben auch die ganze übrige Natur. Daher kann der Dichter so gut die Wollust, wie die Mystik besingen, Anakreon, oder Angelus Silesius seyn, Tragödien, oder Komödien schreiben, die erhabene, oder die gemeine Gesinnung darstellen, – nach Laune und Beruf. Demnach darf Niemand dem Dichter vorschreiben, daß er edel und erhaben, moralisch, fromm, christlich, oder Dies oder Das seyn soll, noch weniger ihm vorwerfen, daß er Dies und nicht jenes sei. Er ist der Spiegel der Menschheit, und bringt ihr was sie fühlt und treibt zum Bewußtseyn.
Betrachten wir nun das Wesen des eigentlichen Liedes näher und nehmen dabei treffliche und zugleich reine Muster zu Beispielen, nicht solche, die sich schon einer andern Gattung, etwan der Romanze, der Elegie, der Hymne, dem Epigramm u.s.w. irgendwie nähern; so werden wir finden, daß das eigenthümliche Wesen des Liedes im engsten Sinne folgendes ist. – Es ist das Subjekt des Willens, d.h. das eigene Wollen, was das Bewußtseyn des Singenden füllt, oft als ein entbundenes, befriedigtes Wollen (Freude), wohl noch öfter aber als ein gehemmtes (Trauer), immer als Affekt, Leidenschaft, bewegter Gemüthszustand. Neben diesem jedoch und zugleich damit wird durch den Anblick der umgebenden Natur der Singende sich seiner bewußt als Subjekts des reinen, willenlosen Erkennens, dessen unerschütterliche, sälige Ruhe nunmehr in Kontrast tritt mit dem Drange des immer beschränkten, immer noch dürftigen Wollens: die Empfindung dieses Kontrastes, dieses Wechselspieles ist eigentlich was sich im Ganzen des Liedes ausspricht und was überhaupt den lyrischen Zustand ausmacht. In diesem tritt gleichsam das reine Erkennen zu uns heran, um uns vom Wollen und seinem Drange zu erlösen: wir folgen; doch nur auf Augenblicke: immer von Neuem entreißt das Wollen, die Erinnerung an unsere persönliche Zwecke, uns der ruhigen Beschauung; aber auch immer wieder entlockt uns dem Wollen die nächste schöne Umgebung, in welcher sich die reine willenlose Erkenntniß uns darbietet. Darum geht im Liede und der lyrischen Stimmung das Wollen (das persönliche Interesse der Zwecke) und das reine Anschauen der sich darbietenden Umgebung wundersam gemischt durch einander: es werden Beziehungen zwischen Beiden gesucht und imaginirt; die subjektive Stimmung, die Affektion des Willens, theilt der angeschauten Umgebung und diese wiederum jener ihre Farbe im Reflex mit: von diesem ganzen so gemischten und getheilten Gemüthszustande ist das ächte Lied der Abdruck. – Um sich diese abstrakte Zergliederung eines von aller Abstraktion sehr fernen Zustandes an Beispielen faßlich zu machen, kann man jedes der unsterblichen Lieder Goethes zur Hand nehmen: als besonders deutlich zu diesem Zweck will ich nur einige empfehlen: »Schäfers Klagelied«, »Willkommen und Abschied«, »An den Mond«, »Auf dem See«, »Herbstgefühl«, auch sind ferner die eigentlichen Lieder im »Wunderhorn« vortreffliche Beispiele: ganz besonders jenes, welches anhebt: »O Bremen, ich muß dich nun lassen.« – Als eine komische, richtig treffende Parodie des lyrischen Charakters ist mir ein Lied von Voß merkwürdig, in welchem er die Empfindung eines betrunkenen, vom Thurm herabfallenden Bleideckers schildert, der im Vorbeifallen die seinem Zustande sehr fremde, also der willensfreien Erkenntniß angehörige Bemerkung macht, daß die Thurmuhr eben halb zwölf weist. – Wer die dargelegte Ansicht des lyrischen Zustandes mit mir theilt, wird auch zugeben, daß derselbe eigentlich die anschauliche und poetische Erkenntniß jenes in meiner Abhandlung über den Satz vom Grunde aufgestellten, auch in dieser Schrift schon erwähnten Satzes sei, daß die Identität des Subjekts des Erkennens mit dem des Wollens, das Wunder kat’ exochên genannt werden kann; so daß die poetische Wirkung des Liedes zuletzt eigentlich auf der Wahrheit jenes Satzes beruht. – Im Verlaufe des Lebens treten jene beiden Subjekte, oder, populär zu reden, Kopf und Herz, immer mehr aus einander: immer mehr sondert man seine subjektive Empfindung von seiner objektiven Erkenntniß. Im Kinde sind Beide noch ganz verschmolzen: es weiß sich von seiner Umgebung kaum zu unterscheiden, es verschwimmt mit ihr. Im Jüngling wirkt alle Wahrnehmung zunächst Empfindung und Stimmung, ja vermischt sich mit dieser; wie dies Byron sehr schön ausdrückt:
I live not in myself, but I become
Portion of that around me; und to me
High mountains are a feeling.71
Eben daher haftet der Jüngling so sehr an der anschaulichen Außenseite der Dinge; eben daher taugt er nur zur lyrischen Poesie, und erst der Mann zur dramatischen. Den Greis kann man sich höchstens noch als Epiker denken, wie Ossian, Homer: denn Erzählen gehört zum Charakter des Greises.
In den mehr objektiven Dichtungsarten, besonders dem Roman, Epos und Drama, wird der Zweck, die Offenbarung der Idee der Menschheit, besonders durch zwei Mittel erreicht: durch richtige und tiefgefaßte Darstellung bedeutender Charaktere und durch Erfindung bedeutsamer Situationen, an denen sie sich entfalten. Denn wie dem Chemiker nicht nur obliegt, die einfachen Stoffe und ihre Hauptverbindungen rein und acht darzustellen; sondern auch, sie dem Einfluß solcher Reagenzien auszusetzen, an welchen ihre Eigenthümlichkeiten deutlich und auffallend sichtbar werden; eben so liegt dem Dichter ob, nicht nur bedeutsame Charaktere wahr und treu, wie die Natur selbst, uns vorzuführen; sondern er muß, damit sie uns kenntlich werden, sie in solche Situationen bringen, in welchen ihre Eigenthümlichkeiten sich gänzlich entfalten und sie sich deutlich, in scharfen Umrissen darstellen, welche daher bedeutsame Situationen heißen. Im wirklichen Leben und in der Geschichte führt der Zufall nur selten Situationen von dieser Eigenschaft herbei, und sie stehn dort einzeln, verloren und verdeckt durch die Menge des Unbedeutsamen. Die durchgängige Bedeutsamkeit der Situationen soll den Roman, das Epos, das Drama vom wirklichen Leben unterscheiden, eben so sehr, als die Zusammenstellung und Wahl bedeutsamer Charaktere: bei Beiden ist aber die strengste Wahrheit unerläßliche Bedingung ihrer Wirkung, und Mangel an Einheit in den Charakteren, Widerspruch derselben gegen sich selbst, oder gegen das Wesen der Menschheit überhaupt, wie auch Unmöglichkeit, oder ihr nahe kommende Unwahrscheinlichkeit in den Begebenheiten, sei es auch nur in Nebenumständen, beleidigen in der Poesie eben so sehr, wie verzeichnete Figuren, oder falsche Perspektive, oder fehlerhafte Beleuchtung in der Malerei: denn wir verlangen, dort wie hier, den treuen Spiegel des Lebens, der Menschheit, der Welt, nur verdeutlicht durch die Darstellung und bedeutsam gemacht durch die Zusammenstellung. Da der Zweck aller Künste nur einer ist, Darstellung der Ideen, und ihr wesentlicher Unterschied nur darin liegt, welche Stufe der Objektivation des Willens die darzustellende Idee ist, wonach sich wieder das Material der Darstellung bestimmt; so lassen sich auch die von einander entferntesten Künste durch Vergleichung an einander erläutern. So z.B. um die Ideen, welche sich im Wasser aussprechen, vollständig aufzufassen, ist es nicht hinreichend, es im ruhigen Teich und im ebenmäßig fließenden Strohme zu sehn; sondern jene Ideen entfalten sich ganz erst dann, wann das Wasser unter allen Umständen und Hindernissen erscheint, die auf dasselbe wirkend, es zur vollen Aeußerung aller seiner Eigenschaften veranlassen. Darum finden wir es schön, wenn es herabstürzt, braust, schäumt, wieder in die Höhe springt, oder wenn es fallend zerstäubt, oder endlich, künstlich gezwungen, als Strahl emporstrebt: so unter verschiedenen Umständen sich verschieden bezeigend, behauptet es aber immer getreulich seinen Charakter: es ist ihm eben so natürlich aufwärts zu spritzen, als spiegelnd zu ruhen; es ist zum Einen wie zum Ändern gleich bereit, sobald die Umstände eintreten. Was nun der Wasserkünstler an der flüssigen Materie leistet, das leistet der Architekt an der starren, und eben dieses der epische oder dramatische Dichter an der Idee der Menschheit. Entfaltung und Verdeutlichung der im Objekt jeder Kunst sich aussprechenden Idee, des auf jeder Stufe sich objektivirenden Willens, ist der gemeinsame Zweck aller Künste. Das Leben des Menschen, wie es in der Wirklichkeit sich meistens zeigt, gleicht dem Wasser, wie es sich meistens zeigt, in Teich und Fluß; aber im Epos, Roman und Trauerspiel werden ausgewählte Charaktere in solche Umstände versetzt, an welchen sich alle ihre Eigenthümlichkeiten entfalten, die Tiefen des menschlichen Gemüths sich aufschließen und in außerordentlichen und bedeutungsvollen Handlungen sichtbar werden. So objektivirt die Dichtkunst die Idee des Menschen, welcher es eigenthümlich ist, sich in höchst individuellen Charakteren darzustellen.
Als der Gipfel der Dichtkunst, sowohl in Hinsicht auf die Größe der Wirkung, als auf die Schwierigkeit der Leistung, ist das Trauerspiel anzusehn und ist dafür anerkannt. Es ist für das Ganze unserer gesammten Betrachtung sehr bedeutsam und wohl zu beachten, daß der Zweck dieser höchsten poetischen Leistung die Darstellung der schrecklichen Seite des Lebens ist, daß der namenlose Schmerz, der Jammer der Menschheit, der Triumph der Bosheit, die höhnende Herrschaft des Zufalls und der rettungslose Fall der Gerechten und Unschuldigen uns hier vorgeführt werden: denn hierin liegt ein bedeutsamer Wink über die Beschaffenheit der Welt und des Daseyns. Es ist der Widerstreit des Willens mit sich selbst, welcher hier, auf der höchsten Stufe seiner Objektität, am vollständigsten entfaltet, furchtbar hervortritt. Am Leiden der Menschheit wird er sichtbar, welches nun herbeigeführt wird, theils durch Zufall und Irrthum, die als Beherrscher der Welt, und durch ihre bis zum Schein der Absichtlichkeit gehende Tücke als Schicksal personificirt, auftreten; theils geht er aus der Menschheit selbst hervor, durch die sich kreuzenden Willensbestrebungen der Individuen, durch die Bosheit und Verkehrtheit der Meisten. Ein und der selbe Wille ist es, der in ihnen allen lebt und erscheint, dessen Erscheinungen aber sich selbst bekämpfen und sich selbst zerfleischen. In diesem Individuo tritt er gewaltig, in jenem schwächer hervor, hier mehr, dort minder zur Besinnung gebracht und gemildert durch das Licht der Erkenntniß, bis endlich, in Einzelnen, diese Erkenntniß, geläutert und gesteigert durch das Leiden selbst, den Punkt erreicht, wo die Erscheinung, der Schleier der Maja, sie nicht mehr täuscht, die Form der Erscheinung, das principium individuationis, von ihr durchschaut wird, der auf diesem beruhende Egoismus eben damit erstirbt, wodurch nunmehr die vorhin so gewaltigen Motive ihre Macht verlieren, und statt ihrer die vollkommene Erkenntniß des Wesens der Welt, als Quietiv des Willens wirkend, die Resignation herbeiführt, das Aufgeben, nicht bloß des Lebens, sondern des ganzen Willens zum Leben selbst. So sehn wir im Trauerspiel zuletzt die Edelsten, nach langem Kampf und Leiden, den Zwecken, die sie bis dahin so heftig verfolgten, und allen den Genüssen des Lebens auf immer entsagen, oder es selbst willig und freudig aufgeben: so den standhaften Prinzen des Calderon; so das Gretchen im »Faust«; so den Hamlet, dem sein Horatio willig folgen möchte, welchen aber jener bleiben und noch eine Weile in dieser rauhen Welt mit Schmerzen athmen heißt, um Hamlets Schicksal aufzuklären und dessen Andenken zu reinigen; – so auch die Jungfrau von Orleans, die Braut von Messina: sie alle sterben durch Leiden geläutert, d.h. nachdem der Wille zu leben zuvor in ihnen erstorben ist; im »Mohammed« von Voltaire spricht sich Dieses sogar wörtlich aus in den Schlußworten, welche die sterbende Palmira dem Mohammed zuruft: »Die Welt ist für Tyrannen: Lebe Du!« – Hingegen beruht die Forderung der sogenannten poetischen Gerechtigkeit auf gänzlichem Verkennen des Wesens des Trauerspiels, ja selbst des Wesens der Welt. Mit Dreistigkeit tritt sie in ihrer ganzen Plattheit auf in den Kritiken, welche Dr. Samuel Johnson zu den einzelnen Stücken Shakespeares geliefert hat, indem er recht naiv über die durchgängige Vernachlässigung derselben klagt; welche allerdings vorhanden ist: denn was haben die Ophelien, die Desdemonen, die Kordelien verschuldet? – Aber nur die platte, optimistische, protestantisch-rationalistische, oder eigentlich jüdische Weltansicht wird die Forderung der poetischen Gerechtigkeit machen und an deren Befriedigung ihre eigene finden. Der wahre Sinn des Trauerspiels ist die tiefere Einsicht, daß was der Held abbüßt nicht seine Partikularsünden sind, sondern die Erbsünde, d.h. die Schuld des Daseyns selbst:
Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido.
(Da die größte Schuld des Menschen
Ist, daß er geboren ward.)
Wie Calderon es geradezu ausspricht.[319]
Die Behandlungsart des Trauerspiels näher betreffend, will ich mir nur eine Bemerkung erlauben. Darstellung eines großen Unglücks ist dem Trauerspiel allein wesentlich. Die vielen verschiedenen Wege aber, auf welchen es vom Dichter herbeigeführt wird, lassen sich unter drei Artbegriffe bringen. Es kann nämlich geschehn durch außerordentliche, an die äußersten Gränzen der Möglichkeit streifende Bosheit eines Charakters, welcher der Urheber des Unglücks wird; Beispiele dieser Art sind: Richard III, Jago im »Othello«, Shylok im »Kaufmann von Venedig«, Franz Moor, Phädra des Euripides, Kreon in der »Antigone«, u. dgl. m. Es kann ferner geschehn durch blindes Schicksal, d.i. Zufall oder Irrthum: von dieser Art ist ein wahres Muster der König Oedipus des Sophokles, auch die Trachinerinnen, und überhaupt gehören die meisten Tragödien der Alten hieher: unter den Neuem sind Beispiele: »Romeo und Juliet«, »Tankred« von Voltaire, »Die Braut von Messina«. Das Unglück kann aber endlich auch herbeigeführt werden durch die bloße Stellung der Personen gegen einander, durch ihre Verhältnisse; so daß es weder eines ungeheuren Irrthums, oder eines unerhörten Zufalls, noch auch eines die Gränzen der Menschheit im Bösen erreichenden Charakters bedarf; sondern Charaktere wie sie in moralischer Hinsicht gewöhnlich sind, unter Umständen, wie sie häufig eintreten, sind so gegen einander gestellt, daß ihre Lage sie zwingt, sich gegenseitig, wissend und sehend, das größte Unheil zu bereiten, ohne daß dabei das Unrecht auf irgend einer Seite ganz allein sei. Diese letztere Art scheint mir den beiden andern weit vorzuziehn: denn sie zeigt uns das größte Unglück nicht als eine Ausnahme, nicht als etwas durch seltene Umstände, oder monströse Charaktere Herbeigeführtes, sondern als etwas aus dem Thun und den Charakteren der Menschen leicht und von selbst, fast als wesentlich Hervorgehendes, und führt es eben dadurch furchtbar nahe an uns heran. Und wenn wir in den beiden andern Arten das ungeheuere Schicksal und die entsetzliche Bosheit als schreckliche, aber nur aus großer Ferne von uns drohende Mächte erblicken, denen wir selbst wohl entgehn dürften, ohne zur Entsagung zu flüchten; so zeigt uns die letzte Gattung jene Glück und Leben zerstörenden Mächte von der Art, daß auch zu uns ihnen der Weg jeden Augenblick offen steht, und das größte Leiden herbeigeführt durch Verflechtungen, deren Wesentliches auch unser Schicksal annehmen könnte, und durch Handlungen, die auch wir vielleicht zu begehn fähig wären und also nicht über Unrecht klagen dürften: dann fühlen wir schaudernd uns schon mitten in der Hölle. Die Ausführung in dieser letztem Art hat aber auch die größte Schwierigkeit; da man darin mit dem geringsten Aufwand von Mitteln und Bewegungsursachen, bloß durch ihre Stellung und Vertheilung die größte Wirkung hervorzubringen hat: daher ist selbst in vielen der besten Trauerspiele diese Schwierigkeit umgangen. Als ein vollkommenes Muster dieser Art ist jedoch ein Stück anzuführen, welches von mehreren andern des selben großen Meisters in anderer Hinsicht weit übertroffen wird: es ist »Clavigo«, »Hamlet« gehört gewissermaaßen hieher, wenn man nämlich bloß auf sein Verhältniß zum Laërtes und zur Ophelia sieht; auch hat »Wallenstein« diesen Vorzug; »Faust« ist ganz dieser Art, wenn man bloß die Begebenheit mit dem Gretchen und ihrem Bruder, als die Haupthandlung, betrachtet; ebenfalls der »Cid« des Corneille, nur daß diesem der tragische Ausgang fehlt, wie ihn hingegen das analoge Verhältniß des Max zur Thekla hat.72
Als die einfachste und richtigste Definition der Poesie möchte ich diese aufstellen, daß sie die Kunst ist, durch Worte die Einbildungskraft ins Spiel zu versetzen. Wie sie dies zu Wege bringt, habe ich im ersten Bande, § 51, angegeben. Eine specielle Bestätigung des dort Gesagten giebt folgende Stelle aus einem seitdem veröffentlichten Briefe Wielands an Merck: »Ich habe drittehalb Tage über eine einzige Strophe zugebracht, wo im Grunde die Sache auf einem einzigen Worte, das ich brauchte und nicht finden konnte, beruhte. Ich drehte und wandte das Ding und mein Gehirn nach allen Seiten; weil ich natürlicherweise, wo es um ein Gemälde zu thun ist, gern die nämliche bestimmte Vision, welche vor meiner Stirn schwebte, auch vor die Stirn meiner Leser bringen möchte, und dazu oft, ut nosti, von einem einzigen Zuge, oder Drucker, oder Reflex, Alles abhängt.« (Briefe an Merck, herausgegeben von Wagner, 1835, S. 193.) – Dadurch, daß die Phantasie des Lesers der Stoff ist, in welchem die Dichtkunst ihre Bilder darstellt, hat diese den Vortheil, daß die nähere Ausführung und die feineren Züge in der Phantasie eines Jeden so ausfallen, wie es seiner Individualität, seiner Erkenntnißsphäre und seiner Laune gerade am angemessensten ist und ihn daher am lebhaftesten anregt; statt daß die bildenden Künste sich nicht so anbequemen können, sondern hier ein Bild, eine Gestalt Allen genügen soll: diese aber wird doch immer, in Etwas, das Gepräge der Individualität des Künstlers, oder seines Modells, tragen, als einen subjektiven, oder zufälligen, nicht wirksamen Zusatz; wenn gleich um so weniger, je objektiver, d.h. genialer der Künstler ist. Schon hieraus ist es zum Theil erklärlich, daß die Werke der Dichtkunst eine viel stärkere, tiefere und allgemeinere Wirkung ausüben, als Bilder und Statuen: diese nämlich lassen das Volk meistens ganz kalt, und überhaupt sind die bildenden die am schwächsten wirkenden Künste. Hiezu giebt einen sonderbaren Beleg das so häufige Auffinden und Entdecken von Bildern großer Meister in Privathäusern und allerlei Lokalitäten, wo sie, viele Menschenalter hindurch, nicht etwan vergraben und versteckt, sondern bloß unbeachtet, also wirkungslos, gehangen haben. Zu meiner Zeit in Florenz (1823) wurde sogar eine Raphael’sche Madonna entdeckt, welche eine lange Reihe von Jahren hindurch im Bedientenzimmer eines Palastes (im Quartiere di S. Spirito) an der Wand gehangen hatte: und Dies geschieht unter Italiänern, dieser vor allen übrigen mit Schönheitssinn begabten Nation. Es beweist, wie wenig direkte und unvermittelte Wirkung die Werke der bildenden Künste haben, und daß ihre Schätzung weit mehr, als die aller andern, der Bildung und Kenntniß bedarf. Wie unfehlbar macht hingegen eine schöne, das Herztreffende Melodie ihre Reise um das Erdenrund, und wandert eine vortreffliche Dichtung von Volk zu Volk. Daß die Großen und Reichen gerade den bildenden Künsten die kräftigste Unterstützung widmen und nur auf ihre Werke beträchtliche Summen verwenden, ja, heut zu Tage eine Idololatrie, im eigentlichen Sinne, für ein Bild von einem berühmten, alten Meister den Werth eines großen Landgutes hingiebt, Dies beruht hauptsächlich auf der Seltenheit der Meisterstücke, deren Besitz daher dem Stolze zusagt, sodann aber auch darauf, daß der Genuß derselben gar wenig Zeit und Anstrengung erfordert und jeden Augenblick, auf einen Augenblick, bereit ist; während Poesie und selbst Musik ungleich beschwerlichere Bedingungen stellen. Dem entsprechend lassen die bildenden Künste sich auch entbehren: ganze Völker, z.B. die Mohammedanischen, sind ohne sie; aber ohne Musik und Poesie ist keines.
Die Absicht nun aber, in welcher der Dichter unsere Phantasie in Bewegung setzt, ist, uns die Ideen zu offenbaren, d.h. an einem Beispiel zu zeigen, was das Leben, was die Welt sei. Dazu ist die erste Bedingung, daß er es selbst erkannt habe: je nachdem dies tief oder flach geschehn ist, wird seine Dichtung ausfallen. Demgemäß giebt es unzählige Abstufungen, wie der Tiefe und Klarheit in der Auffassung der Natur der Dinge, so der Dichter. Jeder von diesen muß inzwischen sich für vortrefflich halten, sofern er richtig dargestellt hat was er erkannte, und sein Bild seinem Original entspricht: er muß sich dem besten gleich stellen, weil er in dessen Bilde auch nicht mehr erkennt, als in seinem eigenen, nämlich so viel, wie in der Natur selbst; da sein Blick nun ein Mal nicht tiefer eindringt. Der beste selbst aber erkennt sich als solchen daran, daß er sieht wie flach der Blick der andern war, wie Vieles noch dahinter lag, das sie nicht wiedergeben konnten, weil sie es nicht sahen, und wie viel weiter sein Blick und sein Bild reicht. Verstände er die Flachen so wenig, wie sie ihn; da müßte er verzweifeln: denn gerade weil schon ein außerordentlicher Mann dazu gehört, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die schlechten Poeten ihn aber so wenig hochschätzen können, wie er sie, hat auch er lange an seinem eigenen Beifall zu zehren, ehe der der Welt nachkommt. – Inzwischen wird ihm auch jener verkümmert, indem man ihm zumuthet, er solle fein bescheiden seyn. Es ist aber so unmöglich, daß wer Verdienste hat und weiß was sie kosten, selbst blind dagegen sei, wie daß ein Mann von sechs Fuß Höhe nicht merke, daß er die Andern überragt. Ist von der Basis des Thurms bis zur Spitze 300 Fuß; so ist zuverlässig eben so viel von der Spitze bis zur Basis. Horaz, Lukrez, Ovid und fast alle Alten haben stolz von sich geredet, desgleichen Dante, Shakespeare, Bako von Verulam und Viele mehr. Daß Einer ein großer Geist seyn könne, ohne etwas davon zu merken, ist eine Absurdität, welche nur die trostlose Unfähigkeit sich einreden kann, damit sie das Gefühl der eigenen Nichtigkeit auch für Bescheidenheit halten könne. Ein Engländer hat witzig und richtig bemerkt, daß merit und modesty nichts[501] Gemeinsames hätten, als den AnfangsbuchstabenA7. Die bescheidenen Celebritäten habe ich stets in Verdacht, daß sie wohl Recht haben könnten; und Corneille sagt geradezu:
La fausse humilité ne met plus en crédit:
Je sçais ce que je vaux, et crois ce qu’on m’en dit.
Endlich hat Goethe es unumwunden gesagt: »Nur die Lumpe sind bescheiden«. Aber noch unfehlbarer wäre die Behauptung gewesen, daß Die, welche so eifrig von Andern Bescheidenheit fordern, auf Bescheidenheit dringen, unablässig rufen: »Nur bescheiden! um Gotteswillen, nur bescheiden!« zuverlässig Lumpe sind, d.h. völlig verdienstlose Wichte, Fabrikwaare der Natur, ordentliche Mitglieder des Packs der Menschheit. Denn wer selbst Verdienste hat, läßt auch Verdienste gelten, – versteht sich ächte und wirkliche. Aber Der, dem selbst alle Vorzüge und Verdienste mangeln, wünscht, daß es gar keine gäbe: ihr Anblick an Andern spannt ihn auf die Folter; der blasse, grüne, gelbe Neid verzehrt sein Inneres: er möchte alle persönlich Bevorzugten vernichten und ausrotten: muß er sie aber leider leben lassen, so soll es nur unter der Bedingung seyn, daß sie ihre Vorzüge verstecken, völlig verleugnen, ja abschwören. Dies also ist die Wurzel der so häufigen Lobreden auf die Bescheidenheit. Und wenn solche Präkonen derselben Gelegenheit haben, das Verdienst im Entstehn zu ersticken, oder wenigstens zu verhindern, daß es sich zeige, daß es bekannt werde, – wer wird zweifeln, daß sie es thun? Denn dies ist die Praxis zu ihrer Theorie. –
Wenn nun gleich der Dichter, wie jeder Künstler, uns immer nur das Einzelne, Individuelle, vorführt; so ist was er erkannte und uns dadurch erkennen lassen will, doch die (Platonische) Idee, die ganze Gattung: daher wird in seinen Bildern gleichsam der Typus der menschlichen Charaktere und Situationen ausgeprägt seyn. Der erzählende, auch der dramatische Dichter nimmt aus dem Leben das ganz Einzelne heraus und schildert es genau in seiner Individualität, offenbart aber hiedurch das ganze menschliche Daseyn; indem er zwar scheinbar es mit dem Einzelnen, in Wahrheit aber mit Dem, was überall und zu allen Zeiten ist, zu thun hat. Hieraus entspringt es, daß Sentenzen, besonders der dramatischen Dichter, selbst ohne generelle Aussprüche zu seyn, im wirklichen Leben häufige Anwendung finden. – Zur Philosophie verhält sich die Poesie, wie die Erfahrung sich zur empirischen Wissenschaft verhält. Die Erfahrung nämlich macht uns mit der Erscheinung im Einzelnen und beispielsweise bekannt: die Wissenschaft umfaßt das Ganze derselben, mittelst allgemeiner Begriffe. So will die Poesie uns mit den (Platonischen) Ideen der Wesen mittelst des Einzelnen und beispielsweise bekannt machen: die Philosophie will das darin sich aussprechende innere Wesen der Dinge im Ganzen und Allgemeinen erkennen lehren. – Man sieht schon hieran, daß die Poesie mehr den Charakter der Jugend, die Philosophie den des Alters trägt. In der That blüht die Dichtergabe eigentlich nur in der Jugend: auch die Empfänglichkeit für Poesie ist in der Jugend oft leidenschaftlich: der Jüngling hat Freude an Versen als solchen und nimmt oft mit geringer Waare vorlieb. Mit den Jahren nimmt diese Neigung allmälig ab, und im Alter zieht man die Prosa vor. Durch jene poetische Tendenz der Jugend wird dann leicht der Sinn für die Wirklichkeit verdorben. Denn von dieser unterscheidet die Poesie sich dadurch, daß in ihr das Leben interessant und doch schmerzlos an uns vorüberfließt; dasselbe hingegen in der Wirklichkeit, so lange es schmerzlos ist, uninteressant ist, sobald es aber interessant wird, nicht ohne Schmerzen bleibt. Der früher in die Poesie als in die Wirklichkeit eingeweihte Jüngling verlangt nun von dieser, was nur jene leisten kann: dies ist eine Hauptquelle des Unbehagens, welches die vorzüglichsten Jünglinge drückt. –
Metrum und Reim sind eine Fessel, aber auch eine Hülle, die der Poet um sich wirft, und unter welcher es ihm vergönnt ist zu reden, wie er sonst nicht dürfte: und das ist es, was uns freut. – Er ist nämlich für Alles was er sagt nur halb verantwortlich: Metrum und Reim müssen es zur andern Hälfte vertreten. – Das Metrum, oder Zeitmaaß, hat, als bloßer Rhythmus, sein Wesen allein in der Zeit, welche eine reine Anschauung a priori ist, gehört also, mit Kant zu reden, bloß der reinen Sinnlichkeit an; hingegen ist der Reim Sache der Empfindung im Gehörorgan, also der empirischen Sinnlichkeit. Daher ist der Rhythmus ein viel edleres und würdigeres Hülfsmittel, als der Reim, den die Alten demnach verschmähten, und der in den unvollkommenen, durch Korruption der früheren und in barbarischen Zeiten entstandenen Sprachen seinen Ursprung fand. Die Armsäligkeit französischer Poesie beruht hauptsächlich darauf, daß diese, ohne Metrum, auf den Reim allein beschränkt ist, und wird dadurch vermehrt, daß sie, um ihren Mangel an Mitteln zu verbergen, durch eine Menge pedantischer Satzungen ihre Reimerei erschwert hat, wie z.B. daß nur gleich geschriebene Silben reimen, als wär’ es für’s Auge, nicht für’s Ohr; daß der Hiatus verpönt ist, eine Menge Worte nicht vorkommen dürfen u. dgl. m., welchem Allen die neuere französische Dichterschule ein Ende zu machen sucht. – In keiner Sprache jedoch macht, wenigstens für mich, der Reim einen so wohlgefälligen und mächtigen Eindruck, wie in der lateinischen: die mittelalterlichen gereimten lateinischen Gedichte haben einen eigenthümlichen Zauber. Man muß es daraus erklären, daß die lateinische Sprache ohne allen Vergleich vollkommener, schöner und edler ist, als irgend eine der neueren, und nun in dem, eben diesen angehörigen, von ihr selbst aber ursprünglich verschmähten Putz und Flitter so anmuthig einhergeht.
Der ernsthaften Erwägung könnte es fast als ein Hochverrath gegen die Vernunft erscheinen, wenn einem Gedanken, oder seinem richtigen und reinen Ausdruck, auch nur die leiseste Gewalt geschieht, in der kindischen Absicht, daß nach einigen Silben der gleiche Wortklang wieder vernommen werde, oder auch, damit diese Silben selbst ein gewisses Hopsasa darstellen. Ohne solche Gewalt aber kommen gar wenige Verse zu Stande: denn ihr ist es zuzuschreiben, daß, in fremden Sprachen, Verse viel schwerer zu verstehn sind, als Prosa. Könnten wir in die geheime Werkstätte der Poeten sehn; so würden wir zehn Mal öfter finden, daß der Gedanke zum Reim, als daß der Reim zum Gedanken gesucht wird: und selbst im letztem Fall geht es nicht leicht ohne Nachgiebigkeit von Seiten des Gedankens ab. – Diesen Betrachtungen bietet jedoch die Verskunst Trotz, und hat dabei alle Zeiten und Völker auf ihrer Seite: so groß ist die Macht, welche Metrum und Reim auf das Gemüth ausüben, und so wirksam das ihnen eigene, geheimnißvolle lenocinium. Ich möchte Dieses daraus erklären, daß ein glücklich gereimter Vers, durch seine unbeschreiblich emphatische Wirkung, die Empfindung erregt, als ob der darin ausgedrückte Gedanke schon in der Sprache prädestinirt, ja präformirt gelegen und der Dichter ihn nur herauszufinden gehabt hätte. Selbst triviale Einfälle erhalten durch Rhythmus und Reim einen Anstrich von Bedeutsamkeit, und figuriren in diesem Schmuck, wie unter den Mädchen Alltagsgesichter durch den Putz die Augen fesseln. Ja, selbst schiefe und falsche Gedanken gewinnen durch die Versifikation einen Schein von Wahrheit. Andererseits wieder schrumpfen sogar berühmte Stellen aus berühmten Dichtern zusammen und werden unscheinbar, wenn getreu in Prosa wiedergegeben. Ist nur das Wahre schön, und ist der liebste Schmuck der Wahrheit die Nacktheit; so wird ein Gedanke, der in Prosa groß und schön auftritt, mehr wahren Werth haben, als einer, der in Versen so wirkt. – Daß nun so geringfügig, ja, kindisch scheinende Mittel, wie Metrum und Reim, eine so mächtige Wirkung ausüben, ist sehr auffallend und wohl der Untersuchung werth: ich erkläre es mir auf folgende Weise. Das dem Gehör unmittelbar Gegebene, also der bloße Wortklang, erhält durch Rhythmus und Reim eine gewisse Vollkommenheit und Bedeutsamkeit an sich selbst, indem er dadurch zu einer Art Musik wird: daher scheint er jetzt seiner selbst wegen dazuseyn und nicht mehr als bloßes Mittel, bloßes Zeichen eines Bezeichneten, nämlich des Sinnes der Worte. Durch seinen Klang das Ohr zu ergötzen, scheint seine ganze Bestimmung, mit dieser daher Alles erreicht und alle Ansprüche befriedigt zu seyn. Daß er nun aber zugleich noch einen Sinn enthält, einen Gedanken ausdrückt, stellt sich jetzt dar als eine unerwartete Zugabe, gleich den Worten zur Musik; als ein unerwartetes Geschenk, das uns angenehm überrascht und daher, indem wir gar keine Forderungen der Art machten, sehr leicht zufrieden stellt: wenn nun aber gar dieser Gedanke ein solcher ist, der an sich selbst, also auch in Prosa gesagt, bedeutend wäre; dann sind wir entzückt. Mir ist aus früher Kindheit erinnerlich, daß ich mich eine Zeit lang am Wohlklang der Verse ergötzt hatte, ehe ich die Entdeckung machte, daß sie auch durchweg Sinn und Gedanken enthielten. Demgemäß giebt es, wohl in allen Sprachen, auch eine bloße Klingklangspoesie, mit fast gänzlicher Ermangelung des Sinnes. Der Sinologe Davis, im Vorbericht zu seiner Uebersetzung des Laou-sang-urh, oder an heir in old age (London 1817); bemerkt, daß die Chinesischen Dramen zum Theil aus Versen bestehn, welche gesungen werden, und setzt hinzu: »Der Sinn derselben ist oft dunkel, und der Aussage der Chinesen selbst zufolge, ist der Zweck dieser Verse vorzüglich, dem Ohre zu schmeicheln, wobei der Sinn vernachlässigt, auch wohl der Harmonie ganz zum Opfer gebracht ist.« Wem fallen hiebei nicht die oft so schwer zu enträthselnden Chöre mancher Griechischen Trauerspiele ein?
Das Zeichen, woran man am unmittelbarsten den ächten Dichter, sowohl höherer als niederer Gattung, erkennt, ist die Ungezwungenheit seiner Reime: sie haben sich, wie durch göttliche Schickung, von selbst eingefunden: seine Gedanken kommen ihm schon in Reimen. Der heimliche Prosaiker hingegen sucht zum Gedanken den Reim; der Pfuscher zum Reim den Gedanken. Sehr oft kann man aus einem gereimten Versepaar herausfinden, welcher von beiden den Gedanken, und welcher den Reim zum Vater hat. Die Kunst besteht darin, das Letztere zu verbergen, damit nicht dergleichen Verse beinahe als bloße ausgefüllte bouts-rimés auftreten.
Meinem Gefühl zufolge (Beweise finden hier nicht Statt) ist der Reim, seiner Natur nach, bloß binär: seine Wirksamkeit beschränkt sich auf die einmalige Wiederkehr des selben Lauts und wird durch öftere Wiederholung nicht verstärkt. Sobald demnach eine Endsilbe die ihr gleichklingende vernommen hat, ist ihre Wirkung erschöpft: die dritte Wiederkehr des Tons wirkt bloß als ein abermaliger Reim, der zufällig auf den selben Klang trifft, aber ohne Erhöhung der Wirkung: er reihet sich dem vorhandenen Reime an, ohne jedoch sich mit ihm zu einem starkem Eindruck zu verbinden. Denn der erste Ton schallt nicht durch den zweiten bis zum dritten herüber: dieser ist also ein ästhetischer Pleonasmus, eine doppelte Courage, die nichts hilft. Am wenigsten verdienen daher dergleichen Reimanhäufungen die schweren Opfer, die sie in Ottavarimen, Terzerimen und Sonetten kosten, und welche die Ursache der Seelenmarter sind, unter der man bisweilen solche Produktionen liest: denn poetischer Genuß unter Kopfbrechen ist unmöglich. Daß der große dichterische Geist auch jene Formen und ihre Schwierigkeiten bisweilen überwinden und sich mit Leichtigkeit und Grazie darin bewegen kann, gereicht ihnen selbst nicht zur Empfehlung: denn an sich sind sie so unwirksam, wie beschwerlich. Und selbst bei guten Dichtern, wann sie dieser Formen sich bedienen, sieht man häufig den Kampf zwischen dem Reim und dem Gedanken, in welchem bald der eine, bald der andere den Sieg erringt, also entweder der Gedanke des Reimes wegen verkümmert, oder aber dieser mit einem schwachen à peu près abgefunden wird. Da dem so ist, halte ich es nicht für einen Beweis von Unwissenheit, sondern von gutem Geschmack, daß Shakespeare, in seinen Sonetten, jedem der Quadernarien andere Reime gegeben hat. Jedenfalls ist ihre akustische Wirkung dadurch nicht im Mindesten verringert, und kommt der Gedanke viel mehr zu seinem Rechte, als er gekonnt hätte, wenn er in die herkömmlichen Spanischen Stiefel hätte eingeschnürt werden müssen.
Es ist ein Nachtheil für die Poesie einer Sprache, wenn sie viele Worte hat, die in der Prosa nicht gebräuchlich sind, und andererseits gewisse Worte der Prosa nicht gebrauchen darf. Ersteres ist wohl am meisten im Lateinischen und Italiänischen, Letzteres im Französischen der Fall, wo es kürzlich sehr treffend la bég[u]eulerie de la langue française genannt wurde. Beides ist weniger im Englischen und am wenigsten im Deutschen zu finden. Solche der Poesie ausschließlich angehörige Worte bleiben nämlich unserm Herzen fremd, sprechen nicht unmittelbar zu uns, lassen uns daher kalt. Sie sind eine poetische Konventionssprache und gleichsam bloß gemalte Empfindungen statt wirklicher: sie schließen die Innigkeit aus. –
Der in unsern Tagen so oft besprochene Unterschied zwischen klassischer und romantischer Poesie scheint mir im Grunde darauf zu beruhen, daß jene keine andern, als die rein menschlichen, wirklichen und natürlichen Motive kennt; diese hingegen auch erkünstelte, konventionelle und imaginäre Motive als wirksam geltend macht: dahin gehören die aus dem Christlichen Mythos stammenden, sodann die des ritterlichen, überspannten und phantastischen Ehrenprincips, ferner die der abgeschmackten und lächerlichen christlichgermanischen Weiberverehrung, endlich die der faselnden und mondsüchtigen hyperphysischen Verliebtheit. Zu welcher fratzenhaften Verzerrung menschlicher Verhältnisse und menschlicher Natur diese Motive aber führen, kann man sogar an den besten Dichtern der romantischen Gattung ersehn, z.B. an Calderon. Von den Autos gar nicht zu reden, berufe ich mich nur auf Stücke wie No siempre ei peor es cierto (Nicht immer ist das Schlimmste gewiß) und El postrero duelo en España (Das letzte Duell in Spanien) und ähnliche Komödien en capa y espada: zu jenen Elementen gesellt sich hier noch die oft hervortretende Scholastische Spitzfindigkeit in der Konversation, welche damals zur Geistesbildung der höhern Stände gehörte. Wie steht doch dagegen die Poesie der Alten, welche stets der Natur treu bleibt, entschieden im Vortheil, und ergiebt sich, daß die klassische Poesie eine unbedingte, die romantische nur eine bedingte Wahrheit und Richtigkeit hat; analog der Griechischen und der Gothischen Baukunst. – Andererseits ist jedoch hier zu bemerken, daß alle dramatischen, oder erzählenden Dichtungen, welche den Schauplatz nach dem alten Griechenland oder Rom versetzen, dadurch in Nachtheil gerathen, daß unsere Kenntniß des Alterthums, besonders was das Detail des Lebens betrifft, unzureichend, fragmentarisch und nicht aus der Anschauung geschöpft ist. Dies nämlich nöthigt den Dichter Vieles zu umgehn und sich mit Allgemeinheiten zu behelfen, wodurch er ins Abstrakte geräth und sein Werk jene Anschaulichkeit und Individualisation einbüßt, welche der Poesie durchaus wesentlich ist. Dies ist es, was allen solchen Werken den eigenthümlichen Anstrich von Leerheit und Langweiligkeit giebt. Bloß Shakespeare’s Darstellungen der Art sind frei davon; weil er, ohne Zaudern, unter den Namen von Griechen und Römern, Engländer seines Zeitalters dargestellt hat.-
Manchen Meisterstücken der lyrischen Poesie, namentlich einigen Oden des Horaz (man sehe z.B. die zweite des dritten Buchs) und mehreren Liedern Goethes (z, B. Schäfers Klagelied), ist vorgeworfen worden, daß sie des rechten Zusammenhanges entbehrten und voller Gedankensprünge wären. Allein hier ist der logische Zusammenhang absichtlich vernachlässigt, um ersetzt zu werden durch die Einheit der darin ausgedrückten Grundempfindung und Stimmung, als welche gerade dadurch mehr hervortritt, indem sie wie eine Schnur durch die gesonderten Perlen geht und den schnellen Wechsel der Gegenstände der Betrachtung so vermittelt, wie in der Musik den Uebergang aus einer Tonart in die andere der Septimenackord, durch welchen der in ihm fortklingende Grundton zur Dominante der neuen Tonart wird. Am deutlichsten, nämlich bis zur Uebertreibung, findet man die hier bezeichnete Eigenschaft in der Canzone des Petrarka, welche anhebt: Mai non vo’ più cantar, com’ io soleva. –
Wie demnach in der lyrischen Poesie das subjektive Element vorherrscht, so ist dagegen im Drama das objektive allein und ausschließlich vorhanden. Zwischen Beiden hat die epische Poesie, in allen ihren Formen und Modifikationen, von der erzählenden Romanze bis zum eigentlichen Epos, eine breite Mitte inne. Denn obwohl sie in der Hauptsache objektiv ist; so enthält sie doch ein bald mehr bald minder hervortretendes subjektives Element, welches am Ton, an der Form des Vertrags, wie auch an eingestreuten Reflexionen seinen Ausdruck findet. Wir verlieren nicht den Dichter so ganz aus den Augen, wie beim Drama.
Der Zweck des Dramas überhaupt ist, uns an einem Beispiel zu zeigen, was das Wesen und Daseyn des Menschen sei. Dabei kann nun die traurige, oder die heitere Seite derselben uns zugewendet werden, oder auch deren Uebergänge. Aber schon der Ausdruck »Wesen und Daseyn des Menschen« enthält den Keim zu der Kontroverse, ob das Wesen, d.i. die Charaktere, oder das Daseyn, d.i. das Schicksal, die Begebenheit, die Handlung, die Hauptsache sei. Uebrigens sind Beide so fest mit einander verwachsen, daß wohl ihr Begriff, aber nicht ihre Darstellung sich trennen läßt. Denn nur die Umstände, Schicksale, Begebenheiten bringen die Charaktere zur Aeußerung ihres Wesens, und nur aus den Charakteren entsteht die Handlung, aus der die Begebenheiten hervorgehn. Allerdings kann, in der Darstellung, das Eine oder das Andere mehr hervorgehoben seyn; in welcher Hinsicht das Charakterstück und das Intriguenstück die beiden Extreme bilden.
Der dem Drama mit dem Epos gemeinschaftliche Zweck, an bedeutenden Charakteren in bedeutenden Situationen, die durch Beide herbeigeführten außerordentlichen Handlungen darzustellen, wird vom Dichter am vollkommensten erreicht werden, wenn er uns zuerst die Charaktere im Zustande der Ruhe vorführt, in welchem bloß die allgemeine Färbung derselben sichtbar wird, dann aber ein Motiv eintreten läßt, welches eine Handlung herbeiführt, aus der ein neues und stärkeres Motiv entsteht, welches wieder eine bedeutendere Handlung hervorruft, die wiederum neue und immer stärkere Motive gebiert, wodurch dann, in der der Form angemessenen Frist, an die Stelle der ursprünglichen Ruhe die leidenschaftliche Aufregung tritt, in der nun die bedeutsamen Handlungen geschehn, an welchen die in den Charakteren vorhin schlummernden Eigenschaften, nebst dem Laufe der Welt, in hellem Lichte hervortreten. –
Große Dichter verwandeln sich ganz in jede der darzustellenden Personen und sprechen aus jeder derselben, wie Bauchredner; jetzt aus dem Helden, und gleich darauf aus dem jungen unschuldigen Mädchen, mit gleicher Wahrheit und Natürlichkeit: so Shakespeare und Goethe. Dichter zweiten Ranges verwandeln die darzustellende Hauptperson in sich: so Byron; wobei dann die Nebenpersonen oft ohne Leben bleiben, wie in den Werken der Mediokren auch die Hauptperson. –
Unser Gefallen am Trauerspiel gehört nicht dem Gefühl des Schönen, sondern dem des Erhabenen an; ja, es ist der höchste Grad dieses Gefühls. Denn, wie wir beim Anblick des Erhabenen in der Natur uns vom Interesse des Willens abwenden, um uns rein anschauend zu verhalten; so wenden wir bei der tragischen Katastrophe uns vom Willen zum Leben selbst ab. Im Trauerspiel nämlich wird die schreckliche Seite des Lebens uns vorgeführt, der Jammer der Menschheit, die Herrschaft des Zufalls und des Irrthums, der Fall des Gerechten, der Triumph der Bösen: also die unserm Willen geradezu widerstrebende Beschaffenheit der Welt wird uns vor Augen gebracht. Bei diesem Anblick, fühlen wir uns aufgefordert, unsern Willen vom Leben abzuwenden, es nicht mehr zu wollen und zu lieben. Gerade dadurch aber werden wir inne, daß alsdann noch etwas Anderes an uns übrig bleibt, was wir durchaus nicht positiv erkennen können, sondern bloß negativ, als Das, was nicht das Leben will. Wie der Septimenackord den Grundackord, wie die röche Farbe die grüne fordert und sogar im Auge hervorbringt; so fordert jedes Trauerspiel ein ganz anderartiges Daseyn, eine andere Welt, deren Erkenntniß uns immer nur indirekt, wie eben hier durch solche Forderung, gegeben werden kann. Im Augenblick der tragischen Katastrophe wird uns, deutlicher als jemals, die Ueberzeugung, daß das Leben ein schwerer Traum sei, aus dem wir zu erwachen haben. Insofern ist die Wirkung des Trauerspiels analog der des dynamischen Erhabenen, indem es, wie dieses, uns über den Willen und sein Interesse hinaushebt und uns so umstimmt, daß wir am Anblick, des ihm geradezu Widerstrebenden Gefallen finden. Was allem Tragischen, in welcher Gestalt es auch auftrete, den eigenthümlichen Schwung zur Erhebung giebt, ist das Aufgehn der Erkenntniß, daß die Welt, das Leben, kein wahres Genügen gewähren könne, mithin unserer Anhänglichkeit nicht werth sei: darin besteht der tragische Geist: er leitet demnach zur Resignation hin.
Ich räume ein, daß im Trauerspiel der Alten dieser Geist der Resignation selten direkt hervortritt und ausgesprochen wird. Oedipus Koloneus stirbt zwar resignirt und willig; doch tröstet ihn die Rache an seinem Vaterland, Iphigenia Aulika ist sehr willig zu sterben; doch ist es der Gedanke an Griechenlands Wohl, der sie tröstet und die Veränderung ihrer Gesinnung hervorbringt, vermöge welcher sie den Tod, dem sie zuerst auf alle Weise entfliehen wollte, willig übernimmt. Kassandra, im Agamemnon des großen Aeschylos, stirbt willig, arkeitô bios (1306); aber auch sie tröstet der Gedanke an Rache. Herkules, in den Trachinerinnen, giebt der Nothwendigkeit nach, stirbt gelassen, aber nicht resignirt. Eben so der Hippolytos des Euripides, bei dem es uns auffällt, daß die ihn zu trösten erscheinende Artemis ihm Tempel und Nachruhm verheißt, aber durchaus nicht auf ein über das Leben hinausgehendes Daseyn hindeutet, und ihn im Sterben verläßt, wie alle Götter von dem Sterbenden weichen: – im Christenthum treten sie zu ihm heran; und eben so im Brahmanismus und Buddhaismus, wenn auch bei letzterem die Götter eigentlich exotisch sind. Hippolytos also, wie fast alle tragischen Helden der Alten, zeigt Ergebung in das unabwendbare Schicksal und den unbiegsamen Willen der Götter, aber kein Aufgeben des Willens zum Leben selbst. Wie der Stoische Gleichmuth von der Christlichen Resignation sich von Grund aus dadurch unterscheidet, daß er nur gelassenes Ertragen und gefaßtes Erwarten der unabänderlich nothwendigen Uebel lehrt, das Christenthum aber Entsagung, Aufgeben des Wollens; eben so zeigen die tragischen Helden der Alten standhaftes Unterwerfen unter die unausweichbaren Schläge des Schicksals, das Christliche Trauerspiel dagegen Aufgeben des ganzen Willens zum Leben, freudiges Verlassen der Welt, im Bewußtseyn ihrer Werthlosigkeit und Nichtigkeit. – Aber ich bin auch ganz der Meinung, daß das Trauerspiel der Neuern höher steht, als das der Alten. Shakespeare ist viel größer als Sophokles: gegen Goethes Iphigenia könnte man die des Euripides beinahe roh und gemein finden. Die Bakchantinnen des Euripides sind ein empörendes Machwerk zu Gunsten der heidnischen Pfaffen. Manche antike Stücke haben gar keine tragische Tendenz; wie die Alkeste und Iphigenia Taurika des Euripides: einige haben widerwärtige, oder gar ekelhafte Motive; so die Antigone und Philoktet. Fast alle zeigen das Menschengeschlecht unter der entsetzlichen Herrschaft des Zufalls und Irrthums, aber nicht die dadurch veranlaßte und davon erlösende Resignation. Alles, weil die Alten noch nicht zum Gipfel und Ziel des Trauerspiels, ja, der Lebensansicht überhaupt, gelangt waren.
Wenn demnach die Alten den Geist der Resignation, das Abwenden des Willens vom Leben, an ihren tragischen Helden selbst, als deren Gesinnung, wenig darstellen; so bleibt es dennoch die eigenthümliche Tendenz und Wirkung des Trauerspiels, jenen Geist im Zuschauer zu erwecken und jene Gesinnung, wenn auch nur vorübergehend, hervorzurufen. Die Schrecknisse auf der Bühne halten ihm die Bitterkeit und Werthlosigkeit des Lebens, also die Nichtigkeit alles seines Strebens entgegen: die Wirkung dieses Eindrucks muß seyn, daß er, wenn auch nur im dunkeln Gefühl, inne wird, es sei besser, sein Herz vom Leben loszureißen, sein Wollen davon abzuwenden, die Welt und das Leben nicht zu lieben; wodurch dann eben, in seinem tiefsten Innern, das Bewußtseyn angeregt wird, daß für ein anderartiges Wollen es auch eine andere Art des Daseyns geben müsse. – Denn wäre dies nicht, wäre nicht dieses Erheben über alle Zwecke und Güter des Lebens, dieses Abwenden von ihm und seinen Lockungen, und das hierin schon liegende Hinwenden nach einem anderartigen, wiewohl uns völlig unfaßbaren Daseyn die Tendenz des Trauerspiels; wie wäre es dann überhaupt möglich, daß die Darstellung der schrecklichen Seite des Lebens, im grellsten Lichte uns vor Augen gebracht, wohlthätig auf uns wirken und ein hoher Genuß für uns seyn könnte? Furcht und Mitleid, in deren Erregung Aristoteles den letzten Zweck des Trauerspiels setzt, gehören doch wahrhaftig nicht an sich selbst zu den angenehmen Empfindungen: sie können daher nicht Zweck, sondern nur Mittel seyn. – Also Aufforderung zur Abwendung des Willens vom Leben bleibt die wahre Tendenz des Trauerspiels, der letzte Zweck der absichtlichen Darstellung der Leiden der Menschheit, und ist es mithin auch da, wo diese resignirte Erhebung des Geistes nicht am Helden selbst gezeigt, sondern bloß im Zuschauer angeregt wird, durch den Anblick großen, unverschuldeten, ja, selbst verschuldeten Leidens. – Wie die Alten, so begnügen auch Manche der Neuern sich damit, durch die objektive Darstellung menschlichen Unglücks im Großen den Zuschauer in die beschriebene Stimmung zu versetzen; während Andere diese durch das Leiden bewirkte Umkehrung der Gesinnung am Helden selbst darstellen: Jene geben gleichsam nur die Prämissen, und überlassen die Konklusion dem Zuschauer; während diese die Konklusion, oder die Moral der Fabel, mitgeben, als Umkehrung der Gesinnung des Helden, auch wohl als Betrachtung im Munde des Chores, wie z.B. Schiller in der Braut von Messina: »Das Leben ist der Güter höchstes nicht.« Hier sei es erwähnt, daß selten die ächt tragische Wirkung der Katastrophe, also die durch sie herbeigeführte Resignation und Geisteserhebung der Helden, so rein motivirt und deutlich ausgesprochen hervortritt, wie in der Oper Norma, wo sie eintritt in dem Duett Qual cor tradisti, qual cor perdesti, in welchem die Umwendung des Willens durch die plötzlich eintretende Ruhe der Musik deutlich bezeichnet wird. Ueberhaupt ist dieses Stück, – ganz abgesehn von seiner vortrefflichen Musik, wie auch andererseits von der Diktion, welche nur die eines Operntextes seyn darf, – und allein seinen Motiven und seiner innern Oekonomie nach betrachtet, ein höchst vollkommenes Trauerspiel, ein wahres Muster tragischer Anlage der Motive, tragischer Fortschreitung der Handlung und tragischer Entwickelung, zusammt der über die Welt erhebenden Wirkung dieser auf die Gesinnung der Helden, welche dann auch auf den Zuschauer übergeht: ja, die hier erreichte Wirkung ist um so unverfänglicher und für das wahre Wesen des Trauerspiels bezeichnender, als keine Christen, noch Christliche Gesinnungen darin vorkommen. –
Die den Neuern so oft vorgeworfene Vernachlässigung der Einheit der Zeit und des Orts wird nur dann fehlerhaft, wann sie so weit geht, daß sie die Einheit der Handlung aufhebt; wo dann nur noch die Einheit der Hauptperson übrig bleibt, wie z.B. in »Heinrich VIII.« von Shakespeare. Die Einheit der Handlung braucht aber auch nicht so weit zu gehn, daß immerfort von der selben Sache geredet wird, wie in den Französischen Trauerspielen, welche sie überhaupt so strenge einhalten, daß der dramatische Verlauf einer geometrischen Linie ohne Breite gleicht: da heißt es stets »Nur vorwärts! Pensez à votre affaire!« und die Sache wird ganz geschäftsmäßig expedirt und depeschirt, ohne daß man sich mit Allotrien, die nicht zu ihr gehören, aufhalte, oder rechts, oder links umsehe. Das Shakespearesche Trauerspiel hingegen gleicht einer Linie, die auch Breite hat: es läßt sich Zeit, exspatiatur: es kommen Reden, sogar ganze Scenen vor, welche die Handlung nicht fördern, sogar sie nicht eigentlich angehn, durch welche wir jedoch die handelnden Personen, oder ihre Umstände näher kennen lernen, wonach wir dann auch die Handlung gründlicher verstehn. Diese bleibt zwar die Hauptsache, jedoch nicht so ausschließlich, daß wir darüber vergäßen, daß, in letzter Instanz, es auf die Darstellung des menschlichen Wesens und Daseyns überhaupt abgesehn ist. –
Der dramatische, oder epische Dichter soll wissen, daß er das Schicksal ist, und daher unerbittlich seyn, wie dieses; – imgleichen, daß er der Spiegel des Menschengeschlechts ist, und daher sehr viele schlechte, mitunter ruchlose Charaktere auftreten lassen, wie auch viele Thoren, verschrobene Köpfe und Narren, dann aber hin und wieder einen Vernünftigen, einen Klugen, einen Redlichen, einen Guten und nur als seltenste Ausnahme einen Edelmüthigen. Im ganzen Homer ist, meines Bedünkens, kein eigentlich edelmüthiger Charakter dargestellt, wiewohl manche gute und redliche: im ganzen Shakespeare mögen allenfalls ein Paar edle, doch keineswegs überschwänglich edle Charaktere zu finden seyn, etwan die Kordelia, der Koriolan, schwerlich mehr; hingegen wimmelt es darin von der oben bezeichneten Gattung. Aber Ifflands und Kotzebues Stücke haben viele edelmüthige Charaktere; während Goldoni es gehalten hat, wie ich oben anempfahl, wodurch er zeigt, daß er höher steht. Hingegen Lessings Minna von Barnhelm laborirt stark an zu vielem und allseitigem Edelmuth: aber gar so viel Edelmuth, wie der einzige Marquis Posa darbietet, ist in Goethes sämmtlichen Werken zusammengenommen nicht aufzutreiben: wohl aber giebt es ein kleines Deutsches Stück »Pflicht um Pflicht« (ein Titel wie aus der Kritik der praktischen Vernunft genommen), welches nur drei Personen hat, jedoch alle drei von überschwänglichem Edelmuth. –
Die Griechen nahmen zu Helden des Trauerspiels durchgängig königliche Personen; die Neuern meistentheils auch. Gewiß nicht, weil der Rang dem Handelnden oder Leidenden mehr Würde giebt: und da es bloß darauf ankommt, menschliche Leidenschaften ins Spiel zu setzen; so ist der relative Werth der Objekte, wodurch dies geschieht, gleichgültig, und Bauerhöfe leisten so viel, wie Königreiche. Auch ist das bürgerliche Trauerspiel keineswegs unbedingt zu verwerfen. Personen von großer Macht und Ansehn sind jedoch deswegen zum Trauerspiel die geeignetesten, weil das Unglück, an welchem wir das Schicksal des Menschenlebens erkennen sollen, eine hinreichende Größe haben muß, um dem Zuschauer, wer er auch sei, als furchtbar zu erscheinen. Euripides selbst sagt: pheu, pheu, ta megala, megala kai paschei kaka. (Stob. Flor. Vol. 2, p. 299.) Nun aber sind die Umstände, welche eine Bürgerfamilie in Noth und Verzweiflung versetzen, in den Augen der Großen oder Reichen meistens sehr geringfügig und durch menschliche Hülfe, ja bisweilen durch eine Kleinigkeit, zu beseitigen: solche Zuschauer können daher von ihnen nicht tragisch erschüttert werden. Hingegen sind die Unglücksfälle der Großen und Mächtigen unbedingt furchtbar, auch keiner Abhülfe von außen zugänglich; da Könige durch ihre eigene Macht sich helfen müssen, oder untergehn. Dazu kommt, daß von der Höhe der Fall am tiefsten ist. Den bürgerlichen Personen fehlt es demnach an Fallhöhe. –
Wenn nun als die Tendenz und letzte Absicht des Trauerspiels sich uns ergeben hat ein Hinwenden zur Resignation, zur Verneinung des Willens zum Leben; so werden wir in seinem Gegensatz, dem Lustspiel, die Aufforderung zur fortgesetzten Bejahung dieses Willens leicht erkennen. Zwar muß auch das Lustspiel, wie unausweichbar jede Darstellung des Menschenlebens, Leiden und Widerwärtigkeiten vor die Augen bringen: allein es zeigt sie uns vor als vorübergehend, sich in Freude auflösend, überhaupt mit Gelingen, Siegen und Hoffen gemischt, welche am Ende doch überwiegen; und dabei hebt es den unerschöpflichen Stoff zum Lachen hervor, von dem das Leben, ja, dessen Widerwärtigkeiten selbst, erfüllt sind, und der uns, unter allen Umständen, bei guter Laune erhalten sollte. Es besagt also, im Resultat, daß das Leben im Ganzen recht gut und besonders durchweg kurzweilig sei. Freilich aber muß es sich beeilen, im Zeitpunkt der Freude den Vorhang fallen zu lassen, damit wir nicht sehn, was nachkommt; während das Trauerspiel, in der Regel, so schließt, daß nichts nachkommen kann. Und überdies, wenn wir jene burleske Seite des Lebens ein Mal etwas ernst ins Auge fassen, wie sie sich zeigt in den naiven Aeußerungen und Geberden, welche die kleinliche Verlegenheit, die persönliche Furcht, der augenblickliche Zorn, der heimliche Neid und die vielen ähnlichen Affekte den vom Typus der Schönheit beträchtlich abweichenden Gestalten der sich hier spiegelnden Wirklichkeit aufdrücken; – so kann auch von dieser Seite, also auf eine unerwartete Art, dem nachdenklichen Betrachter die Ueberzeugung werden, daß das Daseyn und Treiben solcher Wesen nicht selbst Zweck seyn kann, daß sie, im Gegentheil, nur auf einem Irrwege zum Daseyn gelangen konnten, und daß was sich so darstellt etwas ist, das eigentlich besser nicht wäre.
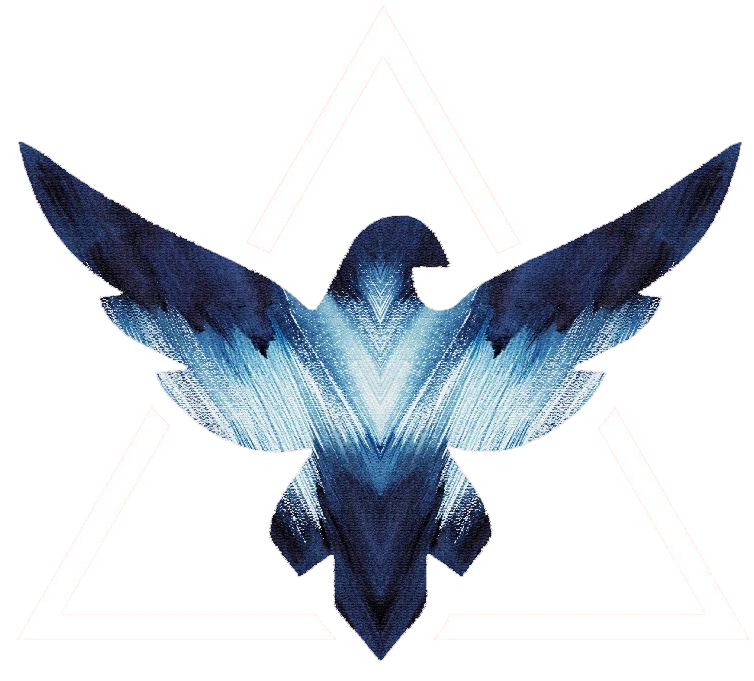

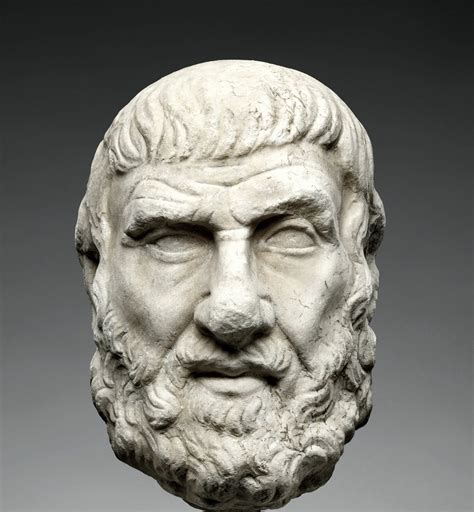

Schreibe einen Kommentar